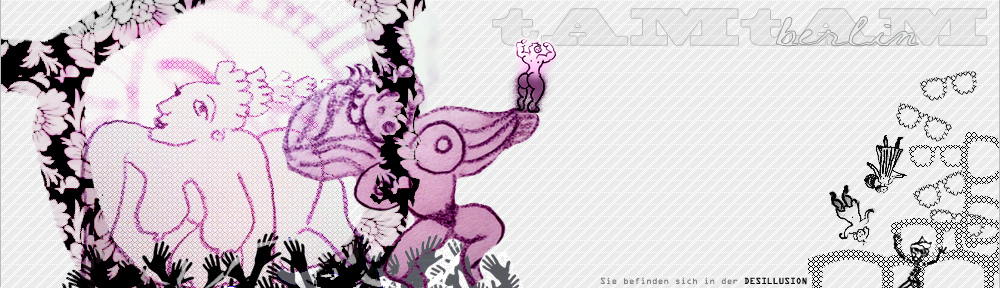tAMtAM meldet sich zurück aus dem Orkus (Was war speziell nochmal der Orkus?) mit einem Exkurs zum Thema Feiern. fei❘ern ist ein schwaches Verb, sozusagen ein angepasstes. Es hat sein angestammtes Substantiv verraten, in der assoziativen Duden-Wortwolke (computergeneriert) triumphiert der Geburtstag, gefolgt von solch schnöden Genossen wie “Bestehen”, “Jubiläum” und “Namenstag”. Die Party und Weihnachten sind auch gut dabei; unten links in der Ecke bibbert dann schließlich klein und irgendwie erbärmlich das FEST. tAMtAM hat nachgemessen, die Schrift ist wirklich genau so groß wie bei Geburtstag, trotzdem wirkt das Fest abgeschlagen, irgendwie lasch und altbacken.
DAS FEST erzählt von einer Familie, der am 60. Geburtstag des Vaters ihre “Harmonie” um die Ohren fliegt. Denn der älteste Sohn Christian eröffnet der versammelten Verwandtschaft, dass seine Schwester und er jahrelang vom Vater missbraucht wurden. Die Schwester hat sich vor wenigen Monaten das Leben genommen. Mit einer wackelige Handkamera folgt Vinterberg den Protagonisten durch das riesige Haus, die Realität scheint immer mehr zum Albtraum zu werden – bis man am Ende versteht, dass sie von Anfang an einer war.
Dogma im Theater – macht man da dann eine castorfsche LiveCam-Show? (tAMtAM denkt kurz vor der Vorstellung mit Schrecken an 5-stündige Exzesse in der Volksbühne Anfang diesen Jahres zurück, macht ein kleines Osterstoßgebet und – wird erhört!)
Regisseur Christopher Rüping entscheidet sich für einen Haufen alter Tische, einen Klavierspieler, überdimensionierte Wollpullis, vielviel Konfetti. Alle spielen alle. Eine Figur kann also ein Mann, eine Frau, ein (gemischter) Chor sein. Die Mehrdeutigkeit, die so entsteht, ist eine der Eigenschaft, die das Theater dem Film voraus hat – die Geschichte von Christian und seinem Vater wird gleichzeitig die Geschichte von Christina (jaja, dummer Vergleich, schon klar) und ihrem Vater/ihrer Mutter/ihren Brüdern, und dennoch ist sie nicht unglaubwürdig.
Gerade weil Theater die Realität nicht eins zu eins abbildet, bekommt der Stoff eine ungeheure Tiefe und Eindringlichkeit – deshalb findet tAMtAM die Texte außerhalb der Dialoge häufig ein bisschen verschenkt. Sie driften ins Beschreibende ab und schaffen dadurch einen (vermeintlichen) Raum, den man eigentlich nicht bräuchte. Die Schauspieler sind nämlich allesamt beeindruckend und vor allem zäh angesichts der radikal absackenden Sympathie in den vorderen 15 Reihen. (Immer, wenn tAMtAM in Stuttgart im Theater hockt, sitzt eine Reihe hinter ihm ein Rentner und sagt während der Vorstellung laut und tief schwäbisch: “So ein Scheiß.” tAMtAM fragt sich inzwischen, ob das vielleicht der Hausgeist ist…)
Das Ganze dauert nicht mal zwei Stunden, doch es reicht, um die österliche Harmonie komplett zu verhackstücken.
Beim Applaus wird daraufhin das Fest in seiner schwäbischen Urform verteidigt und – als das Regie-Team auf die Bühne kommt – so ausgiebig der Vokal U bemüht, dass Intendant Armin Petras beim nächsten Mal mit rausgeht, weil man von der Begeisterung in den hinteren Reihen vorne leider nichts hört. Irgendwie schade.