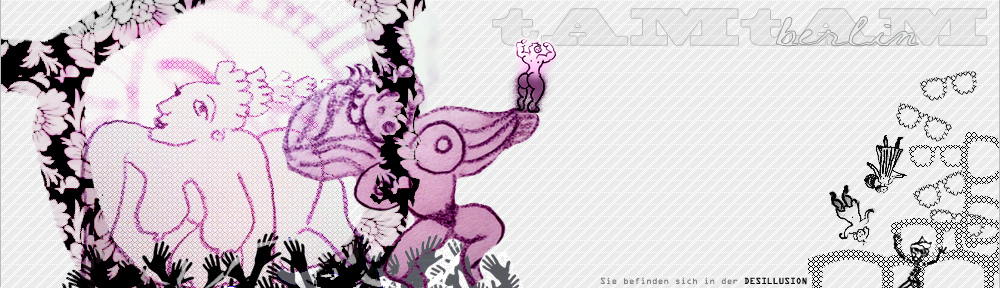Elfriede Jelineks Theaterstücke sind so etwas wie der Obstler der zeitgenössischen Dramatik – ein Destillat ihrer Gesellschaftsphobie, derart hoch konzentriert, dass tAMtAM sich bereits nach den ersten 20 Minuten von Die Straße. Die Stadt. Der Überfall geistig etwas – pardon – verschwurbelt fühlt.
Auf Wunsch von Regisseur Johan Simons hat sich Jelinek die Münchner Maximilianstraße mitsamt ihres menschlichen Mobiliars vorgeknöpft. Die Maximilianstraße ist sozusagen ein monumentales Bildnis, das sich der Münchner Snobismus selbst erschaffen hat und es liegt auf der Hand, dass es dort ein Fülle von Klischees gibt, gegen die man sich wunderbar auflehnen kann.
tAMtAMs kleiner Vorschlag am Rande: Wäre das Münchner Oktoberfest da nicht die bessere Vorlage gewesen? Dort geht‘s immerhin um echte, bayerisch-deftige Körperlichkeit in vollendeter Dekadenz, während auf der Maximilianstraße Körperlichkeit im Prinzip nur simuliert wird. Was den bereits ohnehin entkörperlichten Sphären der Autorin das letzte bisschen Bodenhaftung entzieht.
Möglicherweise wird deshalb zu Beginn der Inszenierung der Bühnenboden mit Eiswürfeln bestückt: Die Schauspieler turnen – Männlein wie Weiblein – auf Highheels über den rutschigen Untergrund und entwickeln durch allerlei Turn- und Catwalk-Übungen jene Körperlichkeit, die der Text nicht hergibt.
Aber worum geht‘s eigentlich?
Eine junge Frau (Sandra Hüller) legt eine gewisse Besessenheit hinsichtlich der auf der Maximilianstraße ausgestellten Klamotten an den Tag. Das Ganze kreist um den Komplex: Ich will so sein wie das Model mit dem Rock – Macht der Rock mich anders? – Der Rock macht mich nicht anders – Ich hasse den Rock.
tAMtAM begeistert Hüllers Spiel, die es schafft, unglaublich lebendig und vielseitig zu sein – trotz der Textmassen, die so lang über einen Gedankenkomplex hinwegwalzen, bis er platt ist. Was dauert.
Nach und nach kristallisieren sich aus den restlichen Darstellern die „Stadtoberen“ heraus, die der jungen Frau schließlich mitteilen, sie sei in der Stadt bzw. der Straße nicht erwünscht und würde ab jetzt verfolgt und irgendwie traktiert. (Wie genau, hat tAMtAM nicht verstanden. Es hatte irgendwas mit sozialer Entblößung zu tun.) Die Straße erhält – um ihr Anliegen auch selbst vertreten zu können – als Informationsträger einen frackgewandeten Schauspieler mit Zylinder.
Auf der Bühne befindet sich auch eine Band; Bläser, Klavier, Keyboard – und ein sehr lebensechter Rudolph Moshammer, der immer mal wieder zu singen beginnt. (Im Publikum ist man offenbar nur auf Sprachmelodie eingestellt. tAMtAM beobachtet Zuschauer, die sich sofort die Ohren zuhalten, sobald Musik ertönt. Dabei war die Lautstärke durchaus moderat. Und allzu schief gesungen hat er auch nicht, der Jelinek-Moshammer.)
Mit der Personifizierung der Straße, an die sich nun der 2005 ermordete Mosi zu klammern beginnt, als er seine – abstrakte – Ermordung erfahren soll, wird die Handlung zunehmend undurchsichtiger. Mosis Mutterkomplex projiziert sich sehr merkwürdig auf „seine“ Maximilianstraße und mündet in ein schier endloses Nicht-gehen-Wollen, das nach tAMtAMs Geschmack auch schon ein Viertelstündchen eher hätte beginnen können.
Aber es wird halt nicht nur in der Oper schön langsam gestorben.